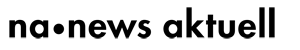Japanische Kräuter sind wie chinesische - nur sauberer
21.12.2004
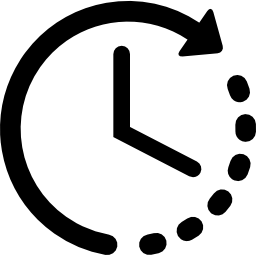 Lesedauer: 5 Minuten
Lesedauer: 5 Minuten
21.12.2004, Die japanische Kampo-Medizin ist im Gegensatz zur chinesischen im Westen noch wenig bekannt.
Ungekocht riechen die japanischen Heilkräuter nach Sellerie. Nach einer halben Stunde im Kochtopf bleibt ein braunes Elixier zurück. Drei Tassen davon pro Tag sollen bei Diabetikern Taubheitsgefühle und Schmerzen in den Füssen lindern. Diese Symptome der "diabetischen Neuropathie" plagen Diabetiker häufig, weil ihre krankheitsbedingt schlechte Durchblutung die Nervenenden schädigt. Also Tee trinken und gesund werden?
In einem schmalen Dachzimmer der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität forscht die Internistin, Japanologin und Kampo-Ärztin Heidrun Reissenweber. Sie leitet seit zehn Jahren die einzige deutsche Forschungsstelle für japanische Phytotherapie. Ziel dieser Abteilung ist es, in Japan klinisch erprobte Phytopharmaka bei Indikationen der inneren Medizin zu prüfen. Bei 25 Diabetikern untersuchte Heidrun Reissenweber in einer Pilotstudie beispielsweise die Wirkung einer Rezeptur mit 10 Heilkräutern, die in Japan seit Jahrhunderten bei Symptomen der "diabetischen Neuropathie" eingesetzt wird. Die Probanden spürten laut Reissenweber Vibrationen, Kälte und Wärme besser, nachdem sie den Kräuterextrakt ein halbes Jahr lang dreimal täglich getrunken hatten. Auch gaben sie an, weniger Schmerzen zu haben. Die Ergebnisse einer Untersuchung mit einer so kleinen Stichprobe können jedoch nur ein Indiz für die Wirksamkeit einer Arznei sein; auch eine Kontrollgruppe fehlte.
Zu kleine Fallzahlen Viele klinische Untersuchungen zu chinesischen und japanischen Heilkräutern arbeiten mit zu kleinen Fallzahlen. Das hat damit zu tun, dass Studien mit einem aussagekräftigen Design leicht einige Millionen Franken kosten können, weil dafür mehrere Hundert Teilnehmer und ein Vergleichsmedikament notwendig sind. Ein schmales Forschungsbudget verweist auch Heidrun Reissenweber in ihre Grenzen. Zudem kennt man zwar die Inhaltsstoffe vieler Arzneipflanzen. Es ist aber noch kaum möglich, die Interaktionen zwischen den Hunderten bis Tausenden von Wirkstoffen, die durchschnittlich in einer Kräutermischung enthalten sind, pharmakologisch aufzuschlüsseln.
Doch muss man überhaupt genau wissen, wie die Kräutermixturen wirken? Genügt nicht die Beobachtung, dass sie helfen? Immerhin werden asiatische Heilkräuter viel länger genutzt als alle allopathischen Medikamente: Chinesen verfügen über etwa 2500 Jahre Erfahrung, Japaner über gut 1500 Jahre. Häufig genügt den Patienten dieses althergebrachte Erfahrungswissen als Beweis für die Wirksamkeit. Sie vertrauen ihrem Arzt und dem Image der Heilkräuterkunde als einer "sanften" Medizin. Diese Akzeptanz der asiatischen Phytotherapie wird noch verstärkt, wenn sich Patienten im schulmedizinischen Betrieb als Nummer durchgeschleust fühlen. Daraus entsteht ein Gefühlsvakuum, das sich leicht mit Geheimnisvollem, wie dem Konzept des Yin und Yang in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM), auffüllen lässt.
Oberflächlich betrachtet mag es wenig Unterschied machen, ob man japanischen oder chinesischen Kräuterabsud schlürft. Viele Rezepte sind ähnlich oder sogar identisch: Der japanische Begriff Kampo bedeutet übersetzt so viel wie "Methode aus der chinesischen Medizin" und entstammt der Kräuterheilkunde, die chinesische Einwanderer im 5. Jahrhundert nach Japan gebracht haben. Doch die Kampo-Medizin hat sich in einigen Aspekten von der TCM emanzipiert. So beschränkt sie sich pragmatisch auf die 250 wirksamsten Heilkräuter der etwa 3000 in der TCM bekannten pflanzlichen, tierischen und mineralischen Heilsubstanzen. Auch die Annahme des "gestörten" und somit krank machenden "Energieflusses", auf welcher die TCM basiert, spielt eine geringe Rolle. "Puls- und Zungenuntersuchung sowie das Abtasten des Bauches nach Spannungs- und Temperaturunterschieden ergänzen lediglich schulmedizinische Diagnosemethoden. Jedes Krankheitsbild kann symptomorientiert einer Rezeptur zugeordnet werden", erklärt Heidrun Reissenweber. Am häufigsten wird die Kampo- Medizin bei funktionellen und chronischen Erkrankungen, Durchblutungsstörungen, chronischer Bronchitis, Hepatitis, Zyklusproblemen, Beschwerden durch die Wechseljahre und Allergien eingesetzt.
Das wohl grösste Plus der Kampo-Medizin ist aber der hohe Qualitätsstandard der Heildrogen. Verwechslungen, schlechte Qualität, geringer Wirkstoffgehalt und Verunreinigungen seien bei japanischen Produkten so gut wie ausgeschlossen. Die Überprüfung nach Rückständen sei gesetzlich vorgeschrieben, werde für jede einzelne Heilmittelcharge durchgeführt und in einem Prüfprotokoll veröffentlicht, so die Münchner Ärztin. Das hat seinen Preis: Japanische Heildrogen sind etwa dreimal so teuer wie chinesische.
Pestizide statt Natur Heidrun Reissenweber ist der Meinung, dass sich der zusätzliche Aufwand lohne. Denn wo Natur draufsteht, steckt mitunter Gift drin, weil die Güte der Kräuter in China nicht nach offiziellen Richtlinien kontrolliert werden muss. Bei Stichproben in europäischen Apotheken tauchen daher immer wieder Kräuter auf, die den Grenzwert der zugelassenen Belastungen mit Düngemitteln, Pestiziden, Insektiziden, Herbiziden und Schwermetallen um das Hundertfache überschreiten. Betroffen waren jüngst vier deutsche Apotheken. Die Schweiz ist bisher von solchen Vorfällen verschont geblieben, obwohl der Bedarf an asiatischen Heilkräutern über chinesische Importe gedeckt wird. Derzeit befriedigen in der Schweiz etwa 1000 Fachleute die Nachfrage nach TCM, davon 700 Mediziner mit Fähigkeitsausweis. Kampo-Medizin dagegen praktiziert in der Schweiz noch niemand.
Warum nun hat sich die Kampo-Medizin in Europa und der Schweiz nicht durchgesetzt? "Während die Chinesen ihr Medizinsystem als finanzkräftigen Exportschlager erkannt haben, besitzen die Japaner diesbezüglich wenig Sendungsbewusstsein", sagt Heidrun Reissenweber. Möglicherweise hat es die Kampo-Medizin in Europa aber auch gerade deshalb schwer, weil die Japaner das alte Heilwissen ihrem hohen Lebensstandard, einer modernen Sozialstruktur und einem anspruchsvollen Gesundheitswesen angepasst haben. Das entspricht unseren Lebensverhältnissen zwar eher als die aus einem Schwellenland stammende TCM. Aber die japanische Phytotherapie ist dadurch auch ihrer mystischen Anmutung entzaubert. Das Bedürfnis nach Geheimnisvollem bleibt da ungestillt.
--- ENDE Pressemitteilung Japanische Kräuter sind wie chinesische - nur sauberer ---
Weitere Informationen und Links:

Ein Angebot von HELP.ch
Swiss-Press.com ist ein Angebot von www.help.ch und die spezialisierte Plattform für Pressemitteilungen aus der Schweiz. HELP.ch sorgt für hohe Reichweite, professionelle Veröffentlichung und maximale Sichtbarkeit Ihrer Unternehmensnews.
Medienpräsenz mit «Aktuelle News»: Nutzen Sie das Netzwerk von «Aktuelle News», um Ihre Presse- und Medienmitteilungen, Events und Unternehmensnews gezielt zu verbreiten.
Ihre Inhalte werden über News-Sites, Google, Social Media und Online-Portale einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zum Netzwerk gehören führende Presseportale wie Aktuellenews.ch, News.help.ch, Swiss-Press.com und Tagesthemen.ch, Eventportale wie Eventkalender.ch und Swisskalender.ch sowie Online-TV-Plattformen wie Aktuellenews.tv und Handelsregister.tv. Insgesamt stehen über 30 Publikationskanäle zur Verfügung, um Ihre Mitteilungen optimal zu platzieren.