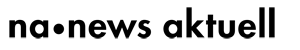Nur die Amerikaner gönnen sich ein noch teureres Gesundheitssystem
18.09.2003
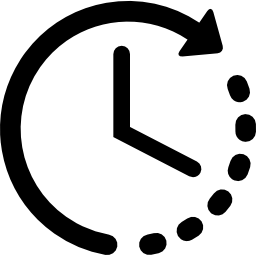 Lesedauer: 8 Minuten
Lesedauer: 8 Minuten
18.09.2003, 11 Prozent des Privatbudgets eines Durchschnittsschweizers gehen bereits dafür drauf. Und weit und breit kein Zeichen, dass die Kosten nicht weiter steigen. Ein falsches Wort geht um, das Wort von der «Kostenexplosion».
Hurra! Die Gesundheitskosten sind vielleicht ein Luxus, aber einer, den wir Schweizerinnen und Schweizer uns weiterhin zu leisten vermögen. 1970 betrug der Anteil der Gesundheitskosten am Bruttoinlandprodukt erst 5,6 Prozent, 1980 waren es 7,6 Prozent, 1990 bereits 8,5 Prozent, im Jahr 2000 waren es 10,7 Prozent, heute sind es über 11 Prozent. Wenigstens in dieser Hinsicht kann die Schweiz ihre frühere weltweite Spitzenposition beibehalten, nur die USA gönnen sich ein noch teureres Gesundheitswesen.
Oder übertreibt die Schweiz etwa? Nicht unbedingt. Vermutlich liesse sich trotz der ständig steigenden Kosten locker eine demokratische Mehrheit gewinnen. Würde man die Leute nämlich fragen: Wollt ihr 11 Prozent eures Budgets gegen die Krankheit ausgeben? - Eine Mehrheit würde wohl antworten: Aber sicher wollen wir das. So viel ist uns die Gesundheit wert.
In diese Richtung zeigt zumindest eine Umfrage, die der Tessiner Gesundheitsökonom Gianfranco Domenighetti im September 2002 durchgeführt hat: «Eine klare Mehrheit der schweizerischen Bevölkerung (66,8 Prozent) ist insgesamt zufrieden mit unserem Gesundheitssystem.» Besonders zufrieden waren, wen erstaunt's, Personen über 66 Jahren und Personen mit einem Monatseinkommen unter 3000 Franken. Bezeichnend für die extrem hohe Akzeptanz der sozialen Krankenversicherung ist ein weiteres Teilresultat: «Personen, die eine Zusatzversicherung abgeschlossen haben, sind insgesamt nicht zufriedener als jene, die nur über die Grundversicherung verfügen.»
Ein zweites falsches Wort geht um, das Wort von der «Prämienexplosion». Es gibt auch bei den Prämien nichts «Explosives» zu vermelden, im Gegenteil. Die Prämien steigen stetig. Zwar etwas steiler als die Kosten, aber ebenfalls konstant. Bei den letzten beiden Malen betrug die Wachstumsrate knapp 10 Prozent, und auch am Montag, 22. September, wenn die Prämien 2004 bekannt werden, dürften es wieder knapp 10 Prozent sein. Offiziell beträgt die Steigerungsrate lediglich rund 5 Prozent, aber das ist nur eine offizielle Zahl, dahinter steckt ein buchhalterischer Trick des Monsieur Couchepin, unseres neuen Sozialministers. In Wahrheit sind es auch diesmal gut 8 Prozent, nur werden gut 3 Prozent der Prämiensteigerungen ab Januar 2004 an der Hintertür eingezogen. Denn Pascal Couchepin setzt die Grundfranchise und den Selbstbehalt herauf, gleichzeitig reduziert er die bisherigen Rabatte für Leute mit erhöhter Wahlfranchisen.
Spätestens an diesem Punkt hört die Freude übers Gesundheitswesen normalerweise auf. «Bei jeder Prämienerhöhung steigt der Anteil der Schweizerinnen und Schweizer, welche die Belastung der Prämie als zu hoch oder gar als übermässig empfinden, deutlich an», hat der Tessiner Domenighetti mit seiner Studie herausgefunden. Nur: Die Pro-Kopf-Prämien mögen in Umfragen unbeliebt sein, politisch sind sie klar mehrheitsfähig. Die SP ist mit ihrer «Gesundheitsinitiative», mit der sie die Pro- Kopf-Prämien abschaffen wollte, am 18. Mai dieses Jahres bös auf die Nase gefallen: 73 Prozent des Volks und sämtliche Kantone sagten nein, nicht einmal in Genf, Basel-Stadt oder der Waadt hatte die Linke eine Chance.
Wo ist die Schmerzgrenze?
Dabei zeigen just die Kantone mit den höchsten Prämien, wohin die Reise mit den Krankenkassen geht. In Basel zahlt eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern bereits 10000 Franken Prämie im Jahr, ein Rentnerpaar kommt schon auf 8500 Franken. Das ist sehr viel verlangt; in Genf wird nochmals mehr Geld für die Prämien verlangt. Wobei sich die Leute in Appenzell Innerrhoden, nur weil sie erst die Hälfte davon bezahlen müssen, darauf nichts einbilden dürfen. Denn auch dort steigen die Prämien auf landesübliche Art an, also rasant, so dass die Appenzellerinnen und Appenzeller das heutige Niveau von Basel-Stadt in acht Jahren ebenfalls erreicht haben werden. Während die Spirale in Basel-Stadt bis dann nochmals ein paar Drehungen weiter ist...
All das sind keine spekulativen Zahlenspielereien, hier schlägt sich der Zinseszinseffekt von Wachstumsraten nieder, der eher früher als später zum politischen Problem jenseits des klassischen Links-rechts-Grabens wird: Die Pro-Kopf-Prämien erreichen schnell, aber sicher ein Niveau, das sich normale Leute nicht mehr leisten können.
Als Lösung wird, wen wundert's, der Staat gerufen: Er soll die Prämien subventionieren. Am Anfang galt das eher für die Ärmeren; bald mussten die nächsthöheren Schichten subventioniert werden, und heute steht der eigentliche Mittelstand an. Je schneller die Prämien wachsen, um so grösser wird die Zahl der Menschen, die bei diesem Tempo nicht mehr Schritt halten können.
Dienstag, 16. September, Bundeshaus. Der Ständerat widerruft seinen eigenen Beschluss, wonach bei Familien die Prämie für das zweite Kind zur Hälfte, ab dem dritten Kind gänzlich gestrichen werden soll. So etwas wäre kaum bezahlbar gewesen, merkten die Politikerinnen und Politiker. Vor allem aber sollen Subventionen nicht via Giesskanne ausgeschüttet werden, heisst es froh, sondern gezielt. Damit meint eine Mehrheit des Ständerats und des Nationalrats: Es wird künftig ein so genanntes Sozialziel geschaffen. Die Prämien für Familien sollen bei den tiefsten Schichten «höchstens 2 Prozent» des steuerbaren Einkommens betragen, bei den oberen Schichten «höchstens 10 Prozent» des steuerbaren Einkommens. Eine analoge Regel soll bei den Haushalten ohne Kinder zum Zuge kommen: Hier schwanken die maximalen Prämien zwischen «höchstens 4 Prozent» und «höchstens 12 Prozent» des steuerbaren Einkommens gemäss Bundessteuer.
Das tönt gut, das tönt human, das tönt gerecht. Allerdings hält dieses hehre «Sozialziel» einer näheren Prüfung nicht stand. Dem Bund und den Kantonen fehlt dazu schlicht das Geld, das belegt schon jede grobe Hochrechnung. In Basel müssten Familien mit Kindern bis zu einem Einkommen von 100000 Franken, kinderlose Paare bis zu einem Einkommen von 70000 Franken subventioniert werden. Und man beachte: Kriterium wäre das «reine Einkommen» gemäss der direkten Bundessteuer, also nach allen Abzügen. Somit würde das «Sozialziel», im Bundeshaus theoretisch beschlossene Sache, in Basel- Stadt praktisch drei Viertel der Bevölkerung zu «Subventionsempfängern» machen; vielleicht wären es sogar vier Fünftel der Bevölkerung. Auf alle Fälle kann sich der Bund so etwas nicht leisten, der Kanton Basel-Stadt schon gar nicht.
Um solche Konsequenzen zu vermeiden, wollen die National- und Ständeräte still und leise etwas schaffen, was die Sanitätsdirektoren offen heraus einen «Schutzparagrafen» nennen. Demnach dürfen die Kantone ein «Höchsteinkommen» festlegen, «bis zu dem Anspruch auf Prämienverbilligung besteht». In einer ersten Phase werden wohl vor allem die drei Kantone mit den höchsten Prämien - Genf, Basel- Stadt, Waadt - auf diese «Schutzparagrafen» zurückgreifen. In acht Jahren aber ist möglicherweise auch Appenzell Innerrhoden soweit, der Kanton mit den tiefsten Prämien der Schweiz.
Prämienverbillig reicht nicht weit
Absehbar ist jedenfalls schon, dass die Gelder für die Prämienverbilligung, die vom Nationalrat und Ständerat beschlossen wurden, nicht weit reichen. Michael Jordi von der Sanitätsdirektorenkonferenz sagt es so: «Die Politiker bestellen etwas wie im Restaurant, haben aber kein Geld zum Zahlen.» Von 2004 bis 2007 sollen die Mittel für die Prämienverbilligung, die der Bund den Kantonen zur Verfügung stellt, um jährlich 1,5 Prozent im Jahr wachsen. Um jährlich 1,5 Prozent - Wie jedes Kind weiss, wachsen die Kosten im Gesundheitswesen steiler an, und wie sich jedes Kind ausrechnen kann, wird damit der Anteil der Prämien, die subventioniert werden, abnehmen. Politisch beabsichtigt war eigentlich das Gegenteil.
Ein klassischer Schildbürgerstreich, der noch einige Zeit überdauern wird. Von ihm betroffen ist ja nur eine Minderheit: Das untere Drittel der Bevölkerung erhält heute schon Prämiensubventionen, in Zukunft auch. Das obere Drittel erhält heute keine Prämiensubventionen, in Zukunft auch nicht. Die einzigen Leidtragenden befinden sich im mittleren Drittel: im Mittelstand, der heute und in Zukunft «knapp zu viel» verdient, um vom Staat subventioniert zu werden. Obschon eigentlich von links bis rechts klar ist: Lange kann sich der Mittelstand diese stetig steigenden Krankenkassenprämien nicht mehr leisten, sonst wird das Wort vom «Mittelstand» zur Illusion.
Und die Lösung des Problems? Dass die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen gestoppt werden, dafür gibt's weit und breit kein Zeichen. Im Gegenteil: Die Alterung der Bevölkerung schreitet voran, der medizinische Fortschritt auch, die Zahl der Ärzte steigt weiter, die Ansprüche der Bevölkerung gleichfalls. Alles deutet darauf hin, dass alles weitergeht wie bisher. Niemand hat ein Rezept gegen den Trend des ständigen Aufwärtsgangs, links wie rechts wird nur Lärm gemacht, um die Ratlosigkeit zu übertönen. Auch die grossspurig angekündigte «Prämiensenkungs-Initiative» der SVP nennt keine Kriterien, welche Leistungen in Zukunft noch bezahlt werden sollen - und vor allem: welche nicht.
Wachsen die Kosten weiter an, müssen sie nicht aus politischen, sondern bald aus mathematischen Gründen neu überwälzt werden. Viel mehr als 10000 Franken im Jahr kann einer gewöhnlichen Familie nicht zugemutet werden. Noch geben Bund und Kantone weniger als 3 Milliarden Franken für die Prämiensubvention aus, das reicht nicht. Das jetzige System der Pro-Kopf-Prämien überlebt die Zukunft nur, wenn auch der Mittelstand subventioniert wird.
Somit würde sich ein alter Streit quasi von selbst erledigen. Die Schweiz wird die angeblich «unsozialen Pro-Kopf-Prämien» nicht abschaffen, so viel ist seit der Volksabstimmung vom 18. Mai klar. Umgekehrt deutet jede Prämienrunde jeden Herbst von neuem darauf hin: Lange dauert's nicht mehr, und dann wird hierzulande ein echtes System von einkommensabhängigen Prämiensubventionen eingeführt. Das wäre in etwa dasselbe, wie wenn die Schweiz einkommensabhängige Prämien einführen würde.
Raymond Rossel, Nicolas Siffert: Gesundheitskosten in der Schweiz. Entwicklung von 1960 bis 2000. Bundesamt für Statistik, Neuenburg, 2003
Gianfranco Domenighetti, Iva Bolgiani, Jacqueline Quaglia: Wie zufrieden sind die Schweizer mit dem Gesundheitssystem und den Krankenkassenprämien? Bundesamt für Sozialversicherung, Bern, Zeitschrift Soziale Sicherheit 4/2003
--- ENDE Pressemitteilung Nur die Amerikaner gönnen sich ein noch teureres Gesundheitssystem ---
Weitere Informationen und Links:

Ein Angebot von HELP.ch
Swiss-Press.com ist ein Angebot von www.help.ch und die spezialisierte Plattform für Pressemitteilungen aus der Schweiz. HELP.ch sorgt für hohe Reichweite, professionelle Veröffentlichung und maximale Sichtbarkeit Ihrer Unternehmensnews.
Medienpräsenz mit «Aktuelle News»: Nutzen Sie das Netzwerk von «Aktuelle News», um Ihre Presse- und Medienmitteilungen, Events und Unternehmensnews gezielt zu verbreiten.
Ihre Inhalte werden über News-Sites, Google, Social Media und Online-Portale einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zum Netzwerk gehören führende Presseportale wie Aktuellenews.ch, News.help.ch, Swiss-Press.com und Tagesthemen.ch, Eventportale wie Eventkalender.ch und Swisskalender.ch sowie Online-TV-Plattformen wie Aktuellenews.tv und Handelsregister.tv. Insgesamt stehen über 30 Publikationskanäle zur Verfügung, um Ihre Mitteilungen optimal zu platzieren.