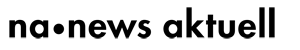Ärzte sind nicht Kostentreiber
17.03.2005
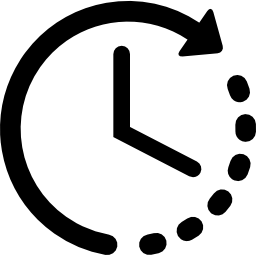 Lesedauer: 11 Minuten
Lesedauer: 11 Minuten
17.03.2005, Gesundheitsausgaben - ETH-Studie widerlegt Vorurteile Ein Forscherteam der Konjunkturforschungsstelle KOF an der ETH Zürich hat untersucht, weshalb die Gesundheitskosten so stark angestiegen sind.
Innerhalb von 15 Jahren ist der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandprodukt von acht auf elf Prozent gestiegen. Für den ETH-Ökonom Bernd Schips ist das keine negative Entwicklung: «Wir ärgern uns ja auch nicht darüber, dass die Kosten für Freizeitaktivitäten ständig steigen.» Die Leistungen im Gesundheitswesen müssten aber effizienter erbracht werden, sagt Schips im Interview. So sei zum Beispiel die mittlere Verweildauer in den Schweizer Spitälern vier Tage länger als in Schweden. (cbo/sig)
---
«Ärztedichte kann Kostenwachstum nicht erklären" Bernd Schips - Der ETH-Ökonom hält die Stabilisierung der Gesundheitsausgaben für eine Illusion Das Schweizer Gesundheitssys-tem ist nicht besser als andere, aber teurer. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung der ETH Zürich. Im Gespräch plädiert der Leiter des Forscherteams für den Abbau überzähliger Spitalkapazitäten, eine neue Pflegeversicherung und Parallelimporte von nicht patentgeschützten Medikamenten. Simon Gemperli
Herr Schips, Sie haben herausgefunden, dass weder die Ärztedichte noch die Medikamentenpreise für die steigenden Kosten im Gesundheitswesen verantwortlich sind. Was sind denn die Kostentreiber? Bernd Schips: Es sind die Spitäler sowie die Heime für Chronischkranke, Betagte und Behinderte. Verantwortlich für steigende Kosten sind neben der Technisierung der Medizin auch gesellschaftliche Entwicklungen.
Was meinen Sie damit? Schips: Demografische Faktoren wie die Überalterung spielen eine Rolle. Dazu kommt, dass heute mehr Frauen berufstätig sind.
Und die Entwicklung der Medikamentenpreise ist vernachlässigbar? Schips: Die Gesamtausgaben für Medikamente haben seit Jahren einen konstanten Anteil an den Gesundkeitskos-ten. Die Krankenkassen geben heute mehr für Medikamente aus, weil es mehr kassenpflichtige Präparate gibt.
Die meisten Medikamente sind im Ausland billiger als in der Schweiz. Das heisst doch, die Kosten in der Schweiz sind höher als nötig. Schips: Es gibt ein paar Länder, wo die Preise kaufkraftbereinigt tiefer liegen. Im Allgemeinen gibt es aber keine grossen Unterschiede.
Sollte die Schweiz Parallelimporte zulassen? Schips: Doch. Ich bin sehr dafür, Parallelimporte von nicht patentgeschützten Medikamenten zuzulassen. Aber nicht von patentgeschützten Produkten.
Das Pharmaunternehmen MSD hat ihre Studie finanziell unterstützt. Wie unabhängig sind die Resultate? Schips: Wir sind ein Institut, das auf Drittmittel angewiesen ist. Die Firma MSD hat keinen Einfluss auf unsere Arbeit gehabt. Ausgangspunkt war ohnehin eine Studie, die wir für den Krankenkassenverband Santésuisse erstellt haben.
Wie kommen Sie zum Schluss, dass die Ärztedichte unwesentlich ist für das Kos-tenwachstum im Gesundheitswesen. Schips: Im Zeitablauf gibt es andere Faktoren, die viel dominanter sind als die Ärztedichte. Diese trägt zur Erklärung des Kostenwachstums praktisch nichts bei.
Wenn Sie die Gesundheitskosten der Kantone vergleichen, lassen sich die Unterschiede aber teilweise auch mit der Ärztedichte erklären. Schips: Das ist so. Im Querschnitt kann man die kantonalen Unterschiede bei den Ausgaben gut auf die Ärztedichte zurückführen.
Was gilt jetzt? Spielt die Ärztedichte eine Rolle oder nicht? Schips: Für die Kostenentwicklung im Zeitablauf ist der Längsschnitt wichtiger. Hier kann die Ärztedichte das Kostenwachstum nicht erklären.
Das bedeutet, dass der Zulassungsstopp für Ärzte aufgehoben werden kann, weil er nichts nützt? Schips: Das würde ich nicht sagen. Der Zulassungsstopp war eine Vorsichtsmassnahme, weil man aufgrund der bilateralen Verträge mit der EU einen Ansturm ausländischer Ärzte befürchtete. Diese Ärzte wären vermutlich dorthin gegangen, wo die Ärztedichte ohnehin hoch ist. Das hätte zu Verzerrungen geführt.
Macht die geplante Aufhebung des Vertragszwangs zwischen Ärzten und Krankenkassen vor dem Hintergrund Ihrer Studie noch Sinn? Schips: Persönlich trete ich für die Aufhebung des Vertragszwangs ein. Das führt zu mehr Wettbewerb, die Leistungserbringer müssen sich anstrengen. Aber wir können aus unseren Ergebnissen keine so konkreten Massnahmen ableiten.
Wie steht die Schweiz im internationalen Vergleich da? Schips: Es gibt Länder mit einem qualitativ gleichwertigen Gesundheitssystem, die aber einen geringeren Anteil ihres Bruttoinlandprodukts dafür aufwenden. Das zeigt, dass es Möglichkeiten gibt, die Effizienz des Systems zu verbessern.
In den schweizerischen Spitälern gibt es teilweise grosse Überkapazitäten. Aber wenn man die Aufenthaltsdauer reduziert, verschiebt man da nicht einfach die Kosten zur Spitex? Schips: Nur zum Teil. Aber die ambulante Behandlung ist wesentlich günstiger als die stationäre.
Möglichst kurze Spitalaufenthalte - ist das nicht auch ein Leistungsabbau? Schips: Ob eine stationäre oder eine ambulante Behandlung notwendig ist, muss natürlich eine Fachperson beurteilen. Aber die Verweildauer hängt heute nicht nur von dieser Fachperson ab, sondern auch von der Hausverwaltung des Spitals, die vor allem um die Bettenbelegung besorgt ist.
Oft wird gefordert, dass die Gesundheitskosten stabilisiert werden müss-ten. Ist das realistisch? Schips: Ich glaube nicht. Wir ärgern uns ja auch nicht darüber, dass die Kos-ten für Freizeitaktivitäten ständig steigen. Deshalb kann es nur darum gehen, die Leistungen, die wir gewohnt sind, so effizient wie möglich zu produzieren.
Wer soll das Gesundheitswesen steuern: der Staat oder der Wettbewerb? Schips: Ich bin überzeugt, dass das Gesundheitssystem ein regulierter Markt sein muss. Das sage ich als überzeugter Marktwirtschafter. Ein ganz privater Krankenversicherungsmarkt kann nicht funktionieren. Man wird nie jemanden vor dem Spital verbluten lassen, nur weil er nicht zahlen kann. Trotzdem soll man Wettbewerbselemente einbauen, wo immer das möglich ist.
Zum Beispiel? Schips: Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass die Krankenversicherer den Kunden Rabatte geben dürften, wenn diese einen Vertrag für drei oder für fünf Jahre abschliessen. Ausserdem verbietet das KVG heute den Krankenkassen, einen Gewinn zu machen. Das gäbe ihnen aber die Motivation, ihre Verwaltungskosten tief zu halten. Und schliesslich ist nicht einzusehen, weshalb die Krankenkassen so hohe gesetzliche Reserven brauchen wie heute.
Die Pflegekosten nehmen rasant zu. Was halten Sie von der Idee, eine Pflegeversicherung für Menschen ab 50 einzuführen? Schips: Pflegebedürftig zu werden ist unter Umständen ein Grossrisiko. Es kann nur in den seltensten Fällen aus dem eigenen Vermögen gedeckt werden. Weshalb machen wir es nicht wie bei der Krankenversicherung? Krankheit ist auch ein Grossrisiko.
Und weshalb sollen die Jungen keine Beiträge an diese Pflegeversicherung bezahlen? Schips: Das würde die jüngeren Versicherten entlasten. Im Durchschnitt hat man im Alter von 50 Jahren am meisten Vermögen. Rentnerhaushalte vererben immer mehr an Rentnerhaushalte.
Wo steigen die Kosten im Gesundheitssystem? Empirische Analyse - KOF durchleuchtet Gesundheitswesen Jahr für Jahr steigen die Gesundheitskosten, Jahr für Jahr werden Schuldige gesucht. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) unter der Leitung von Prof. Bernd Schips hat das Gesundheitssystem analysiert.
Christoph Bopp Schweizerinnen und Schweizer lassen sich ihre Gesundheit gegenwärtig rund 50 Milliarden Franken im Jahr kosten. Der Anteil am BIP stieg in den letzten 15 Jahren von knapp 8 Prozent (1985) auf fast 11 Prozent (2001). Diesem Aufwand steht eine Steigerung der Lebenserwartung von rund 77 Jahren auf 80 Jahre (Frauen und Männer) gegenüber. Die Todesfälle allgemein und durch Herz- und Kreislaufkrankheiten haben abgenommen (siehe Grafik). Umfragen wie der «Gesundheitsmonitor 2004» (gfs bern) haben ergeben, dass die Bevölkerung mit den Leistungen des Gesundheitssystems weitgehend zufrieden ist. Stark gestiegen sind die Kosten für ambulante Behandlung in Spitälern. Dies wird aber mit einem Rückgang bei der stationären Behandlung kompensiert: Die mittlere Aufenthaltsdauer im Spital betrug 1960 noch mehr als einen Monat, 2002 waren es noch 12,7 Tage. Das ist allerdings rund ein Tag mehr als in Deutschland und rund vier Tage mehr als in Schweden.
Mangelhafte Datenlage Kein Kostentreiber seien - so die Analyse - entgegen landläufiger Annahmen die Medikamente. Der Anteil der Medikamentenkosten an den Gesamtausgaben stagniert seit 1997 bei 10,3 Prozent. Inwiefern Medikamente die Lebenserwartung erhöhen, ist umstritten. Amerikanische Schätzungen kommen auf 40 Prozent. Die Datenlage verhindere, dies auf Schweizer Verhältnisse zu übertragen, es gäbe aber «weiche Evidenz», dass der medizinische Fortschritt auch hierzulande zu «erheblichen Nutzensteigerungen» geführt habe. Allgemein wurde die schlechte Datenlage beklagt. «Wir brauchen mehr Daten, nicht um eine Big- Brother-Kontrolle auszuüben, sondern damit wir Tendenzen und Entwicklungen verfolgen können», sagte Yves Seydoux, Delegierter für Öffentlichkeitsarbeit der santésuisse. Aus den Da-ten haben die Autoren der Studie ein ökonometrisches Modell entwickelt. Es sollte einigermassen zuverlässige Prognosen der Kostenentwicklung in den nächsten Jahren liefern. Für die Jahre bis 2006 sagt das Modell ein jährliches Ausgabenwachstum zwischen 3,5 und 4,1 Prozent voraus.
Und die Politik? «Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, welche Leistungen für sinnvoll erachtet werden», sagte Dr. Ludwig-Theodor Heuss, Mitglied des Zentralvorstandes FMH. Die Frage ist, wie ein solcher erzielt werden könnte. Der gesellschaftliche Umgang mit Risiken wandelt sich, bei Jugendlichen nimmt die Fettleibigkeit zu, die Berufstätigkeit beider Elternteile bleibt nicht ohne Folgen. Mehr als ein Appell an mehr Eigenverantwortung scheint kaum möglich. Die zunehmende Prämienverbilligung vermindere die «Steuerung übers Portemonnaie». Kommt hinzu, dass die Politik vor einem Leistungsabbau weitgehend zurückschreckt, weil sie eine «Zweiklassenmedizin» fürchtet. Die Wertschöpfung im Gesundheitswesen nahm in den letzten Jahren kontinuierlich zu und nähert sich 6 Prozent, das ist aber markant weniger, als die Beschäftigung wächst (2002: rund 10 Prozent).
Über 28 Jahre fast jede zweite Nacht Notfalldienst»
Ärztemangel - Peter Hirzel, Landarzt in Göschenen, sucht einen Nachfolger für seine Praxis - und findet keinen 28 Jahre war Peter Hirzel Landarzt in Göschenen UR. Jetzt, mit 58, möchte er endlich etwas mehr Zeit haben für sein Cello. Doch noch immer arbeitet er in seiner Praxis, weil sich noch kein Nachfolger finden lässt.
Ueli Bachmann Sein Zürcherdialekt verrät den Göschener Hausarzt Peter Hirzel, dass er eben kein echter «Ürner» ist. Nach Göschenen wollte er eigentlich «niemals im Leben», doch als er vor 28 Jahren mit seiner Frau und den drei Kindern nach einem Aufenthalt in Neuseeland das prächtige Jugendstilhaus des Dichters und Politikers Emil Zahn sahen, das die Gemeinde für den Landarzt bereithielt, war es um sie geschehen.
Hausarzt sein, in einer herrlichen Landschaft und mit dieser Nähe zur Bevölkerung, sei ein interessanter und schöner Job, ein Privileg, sagt Hirzel. Er betreute Patienten in der Praxis in Göschenen, tat Dienst im Armeespital in Andermatt; er wurde zu Verkehrsunfällen auf der A2 aufgeboten, er war beim Brand im Gotthardtunnel als Notfallarzt vor Ort und immer wieder unterwegs etwa zur Göscheneralp oder ins Meiental, früher schon mal zu Fuss, meist aber mit dem Auto und im Winter mit dem Snowmobil. Jetzt aber, im Alter von 58 Jahren, will Peter Hirzel mehr Zeit haben für das geliebte Cellospiel. Und er will mit seiner Frau, einer Berufsmusikerin, Konzerte besuchen, über Wochenenden zu seinem Sohn, einem Jazzpianisten, oder zur Tochter, einer Balletttänzerin, fahren oder ganz einfach die Nächte stresslos durchschlafen ohne durch Telefonanrufe geweckt zu werden. «Ich weiss, was Burnout bedeutet», sagt Hirzel.
Der Neue taugte zwei Tage Peter Hirzel hat Göschenen inzwischen verlassen und mit seiner Frau ein neues Haus in Altdorf bezogen. Einen Nachfolger für die Praxis fand er nicht. «Die Reaktionen auf meine Inserate waren gleich null», sagt er. Vergangenes Jahr fand er einen Käufer in der Mediprax GmbH mit Sitz in Luzern. Sie zahlte gerade mal 25 000 Franken. Das genüge nicht als Pensionsgeld, wie sich das viele Landärzte vom Erlös ihrer Praxen erhoffen, aber es sei halt ein marktüblicher Preis, sagt Paul Gabriel von der Mediprax. Der Praxenvermittler machte sich ebenfalls auf die Suche. Er präsentierte einen deutschen Arzt «mit besten Diplomen» als Nachfolger. Dieser nahm die Arbeit auf, schaffte es aber, sich innerhalb von zwei Tagen mit allen zu überwerfen. Das Experiment musste abgebrochen werden. Seither steht Peter Hirzel wieder in seiner Praxis. Die Arbeit teilt er sich mit einem Kollegen; Notfalldienst hat er keinen mehr zu leisten.
Bis zum Frühling will Paul Gabriel von der Mediprax die Nachfolge geregelt haben. Zwar lassen der Numerus clausus bei der Zulassung zum Medizinstudium und auch der Zulassungsstopp für die Tätigkeit in der freien Praxis für Ärzte auf einen Ärzteüberschuss schliessen. Stattdessen zeichnet sich auf dem Land ein Ärztemangel ab. Die unregelmässigen Arbeitszeiten, ständige Präsenz und geringe Verdienstmöglichkeiten, die rund 25 Prozent unter jenen der Kollegen in den Städten liegen, machen die Suche schwierig.
«Früher hatten Ärzte eine Portion Idealismus; wir waren wie beseelt vom Helfersyndrom», sagt Hirzel. Heute wollten die jungen Ärzte nicht mehr aufs Land, sie suchten einen finanziell besseren und weniger riskanten Job mit geregelten Arbeitszeiten und mehr Möglichkeiten für Freizeit und Familie. Hirzel hat dafür ein gewisses Verständnis, denn er kennt die Tücken des Landarzt- Berufes. «In all den 28 Jahren habe ich praktisch alle zwei Tage Notfalldienst geleistet und war jedes zweite Wochenende verplant gewesen.»
Und das ohne fürstliche Entlöhnung: Durch den Rückgang der Bevölkerungszahl in Göschenen um rund die Hälfte in den letzten 20 Jahren gab es weniger Einsätze an Notfalldiensttagen, bereithalten musste sich Hirzel trotzdem. Auch viele Neuerungen schlagen finanziell negativ zu Buche. Das «Wartgeld» sei seit 50 Jahren unverändert geblieben, sagt Hirzel. Und mit der Einführung des neuen Arzttarifs Tarmed, der eigentlich zur Brechung der Spitzen bei den Arztlöhnen eingeführt worden ist, habe sich für ihn wenig bis gar nichts geändert. Der Tarmed verleite Landärzte nur dazu, Leis-tungen zu verrechnen, die gar nicht gemacht wurden. Lange Anfahrtswege oder das lange Warten auf den Heli, wie kürzlich beim Abtransport einer von ihm betreuten verunfallten Skifahrerin, würden nicht angemessen abgegolten.
Image als Abzocker und Kostentreiber 150 000 Franken beträgt sein Jahresbruttolohn, das liegt um rund einen Fünftel unter dem durchschnittlichen Verdienst der Allgemeinpraktiker in der Schweiz. All diese Einschränkungen, dazu das schlechte Image des Arztes in den Medien als Kostentreiber im Gesundheitswesen und Abzocker: «Ich verstehe, wenn Junge nicht mehr aufs Land wollen.»
Peter Hirzel sagt es engagiert, als hätte er sich nicht schon mit einem Schritt aus diesem Beruf verabschiedet. Dabei hat er einiges neu eingerichtet. Er geniesst jetzt Freizeitaktivitäten, die er sich als Landarzt nie leisten konnte, spielt im Kammerorchester Uri und ist der SP Altdorf beigetreten. Nur an eines hat er sich noch nicht gewöhnt: «Es ist schon eigenartig, nachts nicht mehr geweckt und zu einem Notfall gerufen zu werden.»
--- ENDE Pressemitteilung Ärzte sind nicht Kostentreiber ---
Weitere Informationen und Links:

Ein Angebot von HELP.ch
Swiss-Press.com ist ein Angebot von www.help.ch und die spezialisierte Plattform für Pressemitteilungen aus der Schweiz. HELP.ch sorgt für hohe Reichweite, professionelle Veröffentlichung und maximale Sichtbarkeit Ihrer Unternehmensnews.
Medienpräsenz mit «Aktuelle News»: Nutzen Sie das Netzwerk von «Aktuelle News», um Ihre Presse- und Medienmitteilungen, Events und Unternehmensnews gezielt zu verbreiten.
Ihre Inhalte werden über News-Sites, Google, Social Media und Online-Portale einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zum Netzwerk gehören führende Presseportale wie Aktuellenews.ch, News.help.ch, Swiss-Press.com und Tagesthemen.ch, Eventportale wie Eventkalender.ch und Swisskalender.ch sowie Online-TV-Plattformen wie Aktuellenews.tv und Handelsregister.tv. Insgesamt stehen über 30 Publikationskanäle zur Verfügung, um Ihre Mitteilungen optimal zu platzieren.