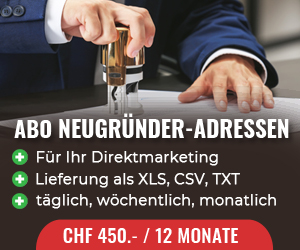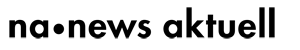Kostendämpfung dank Managed Care
24.07.2003
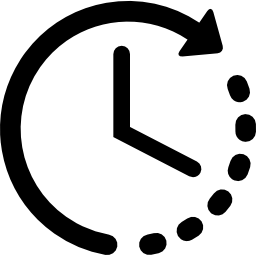 Lesedauer: 7 Minuten
Lesedauer: 7 Minuten
24.07.2003, Risikobereinigte Ersparnisse von 10 bis 30 Prozent Managed-Care-Modelle weisen gegenüber der traditionellen Versicherung Effizienzvorteile von 10 bis 30% auf. Damit sich diese Versicherungsformen weiterentwickeln können, gilt es, die Spitalfinanzierung und den Risikoausgleich zu reformieren sowie den Vertragszwang aufzuheben.
Versicherungsmodelle mit eingeschränkter Arztwahl haben den "Start- up"-Charakter in der Schweiz abgelegt. Zwischen 1994 und 2000 hat sich der Anteil der Bevölkerung in neuen Versicherungsformen von 0,35% auf 8% erhöht. Nach anfänglicher Skepsis sind Health Maintenance Organisations (HMO) und Hausarztmodelle (HAM) zu Hoffnungsträgern avanciert. Man verspricht sich von ihnen eine Effizienzsteigerung.
Effizienz oder Risikoselektion?
Wie sind die bisherigen Erfahrungen mit HMO und HAM in der Schweiz? Wie schneiden sie im Vergleich zur traditionellen Versicherung ab? Eine Antwort wird dadurch erschwert, dass Managed-Care-Modelle einen "natürlichen" Kostenvorteil besitzen, weil sich eher gesündere Personen solchen Versicherungsformen angeschlossen haben. Würde man den Gesundheitszustand jedes Versicherten genau kennen, liesse sich bestimmen, welcher Teil der Kostendifferenz gegenüber der herkömmlichen Versicherung auf Unterschiede im Risikokollektiv und welcher auf geänderte Anreize für die Leistungserbringer und Versicherten zurückzuführen ist. Da sich der jeweilige Gesundheitszustand aber nicht präzis messen lässt, behilft sich die Forschung mit Indikatoren wie Alter, Geschlecht, Bildung oder den Gesundheitskosten in der Vergangenheit. Die erste HMO-Untersuchung wurde 1998 vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) publiziert. Ausgewertet wurden Daten von 5000 Versicherten. Die Kosten bei den Mitgliedern eines Gesundheitszentrums lagen im Durchschnitt 40% unter denjenigen der traditionell Versicherten. Nach der Berücksichtigung soziodemographischer Merkmale einschliesslich Bildung sowie von Behinderung, chronischer Krankheit und subjektiver Einschätzung des Gesundheitszustandes betrug die Kostenersparnis 20 bis 25%. Geben diese Zahlen die Effizienzvorteile wieder? Wurde die Kostendifferenz um die wichtigsten gesundheitsrelevanten Faktoren bereinigt? Im Allgemeinen ist Studienergebnissen umso mehr Vertrauen zu schenken, je besser die verwendeten Indikatoren den Gesundheitszustand abbilden. Allerdings können selbst mit detailliertesten Informationen im besten Fall nur 25 bis 35% der Gesundheitskosten erklärt werden, weil Krankheiten und Unfälle oft zufällig auftreten. Die vom BSV herangezogenen Merkmale erklären nur 5% der individuellen Kosten. Mit der Berücksichtigung von vergangenen Krankheitskosten und Diagnose- Informationen liesse sich dieser Wert immerhin verdoppeln.
Beide Angaben fanden Eingang in die Wirkungsanalyse des Hausarztmodells Aarau von Matthias Schwenkglenks und Thomas Szucs (Hirslanden Research). Für jede der 466 untersuchten Personen standen neben den Gesundheitskosten im Jahr 2000 auch jene von 1996 sowie die jeweilige Patientengeschichte zur Verfügung. Die "echten" Kostenersparnisse des Hausarztmodells werden von den Verfassern auf 7 bis 20% veranschlagt. Im Aarauer Modell werden die Hausärzte wie ihre Kollegen ausserhalb des Netzes pro Einzelleistung honoriert. Somit existieren keine Anreize zur Kosteneinsparung. Schwenkglenks vermutet hinter den Effizienzvorteilen die Wirkung des "Gatekeeping". Anlaufstelle für Patienten in Managed- Care-Modellen ist immer zuerst der Hausarzt, der über das weitere Behandlungsprozedere befindet. Hierdurch eröffnet sich die Chance einer verbesserten Koordination der medizinischen Leistungen.
Nachhaltiger Kostenvorteil der HMO
Die Aussagekraft der Untersuchung wird durch die geringe Zahl der Fälle gemindert. Ausserdem handelt es sich bei ihr wie bei der BSV-Studie um eine Momentanaufnahme. Damit lässt sich nicht eruieren, ob die Erfolge von Managed-Care-Modellen nachhaltig sind. Diese Handicaps weist eine Arbeit des Sozioökonomischen Instituts der Universität Zürich nicht auf. In ihr werden die Daten von 500"000 Kunden der Krankenkasse Swica aus den Jahren 1997 bis 2002 ausgewertet. Mit Hilfe der individuellen Kosten aus den Vorjahren schätzen die Zürcher Ökonomen Peter Zweifel und Lukas Steinmann den Gesundheitszustand jeder Person. Weist z."B. ein Patient in den Vorjahren wiederholt hohe Kosten auf, deutet dies auf eine chronische Krankheit. Entsprechend ordnet das Schätzverfahren der betroffenen Person einen tiefen Wert für ihren Gesundheitszustand zu.
Den gesamten Kostenvorsprung der HMO gegenüber einer konventionellen Versicherung beziffern die beiden Volkswirte auf rund 70% (vgl. Tabelle). Davon beruht die eine Hälfte auf einer günstigeren Risikostruktur der Patienten - die HMO wird also vergleichsweise oft von gesunden Personen gewählt - , die andere auf Effizienzgewinnen. Die Studie belegt, dass diese Effizienzvorteile über die Jahre ziemlich konstant geblieben sind. Sie lassen sich auf zwei Ursachen zurückführen. Zum einen suchen Managed-Care-Versicherte weniger häufig einen Arzt auf ("Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme"). Falls Leistungen in Anspruch genommen werden, ist zum anderen der Behandlungsstil weniger kostenintensiv ("Behandlungskosten"). Auf letzteren Effekt entfallen rund 75% der Effizienzgewinne.
Weniger erspriesslich hat sich das Hausarztmodell (HAM) entwickelt, das von der Swica in den Kantonen Thurgau und St."Gallen angeboten wird. Die Differenz der Ausgaben pro Versicherten zum traditionellen Modell beträgt zwar Jahr für Jahr rund 40%. Im Unterschied zu den HMO hat sich der Effizienzvorteil aber seit 1998 von 24 auf 13,5% kontinuierlich zurückgebildet. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Erfahrungen des Swica- Managements. Nach der Anfangseuphorie habe sich im Hausarztmodell nichts mehr bewegt, beklagt Swica-Firmenchef Hans-Ueli Regius. Bestrebungen, die Hausärzte stärker in die Budgetverantwortung einzubinden, seien bisher wegen mangelnder finanzieller Anreize gescheitert.
Politischer Handlungsbedarf
Zurzeit diskutieren die eidgenössischen Räte die zweite Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG). Demnach sollen die Versicherer zum Angebot von Managed-Care-Modellen verpflichtet werden. Dies würde die Definition solcher Modelle nötig machen. Eine solche Festschreibung wäre auch notwendig, sollte sich der Vorschlag eines differenzierten Selbstbehalts durchsetzen, der dem Ständerat vorschwebt. Dabei sollen Mitglieder von Managed-Care-Modellen einen Selbstbehalt von 10% bezahlen, traditionell Versicherte müssten dagegen 20% der zusätzlichen Kosten selbst berappen (bis zu einem Maximum von 700"Fr.). Es darf bezweifelt werden, dass die vorgesehenen Regulierungen dem Gedeihen innovativer Versicherungsformen zuträglich sind. Vonnöten ist vielmehr die Beseitigung bestehender Hindernisse. Der an sich mögliche Wettbewerbs- und Kostendruck der Managed-Care-Modelle wird besonders aus drei Gründen stark reduziert. Erstens durch den Vertragszwang. Er erschwert es, die Ärzte in die finanzielle Verantwortung einzubinden. Solange der Arzt weiss, dass die Versicherung auf Grund des Kontrahierungszwangs jede Einzelleistung begleichen muss, besitzt er keinen Anreiz, Budgetverantwortung und damit ein gewisses finanzielles Risiko zu übernehmen. Die harzige Entwicklung bei den Hausarztmodellen zeigt, dass nur geringe Ersparnisse erzielt werden können, solange die Einzelleistungsvergütung beibehalten wird. Zweitens gilt es, die Spitalfinanzierung von den Kantonen zu lösen. Die von den Räten akzeptierte Regelung, die Kosten in der allgemeinen Abteilung zwischen Kanton und Kasse je hälftig aufzuteilen, diskriminiert Managed- Care- Modelle weiterhin. HMO erzielen ihre Kostenersparnisse zu einem guten Teil über geringere Hospitalisationsraten. Wegen der hälftigen Subventionierung der stationären Leistungen können sie nur einen Teil der effektiven Kosteneinsparung selber realisieren und in Form reduzierter Prämien an ihre Versicherten weitergeben.
Schliesslich sollte, drittens, der Risikoausgleich, der Zahlungen an Kassen mit einer ungünstigen Versichertenstruktur leistet, um das Kriterium Managed Care erweitert werden. Zurzeit muss für Managed-Care- Versicherte die gleiche Ausgleichszahlung geleistet werden wie für herkömmlich Versicherte. Dadurch findet eine Quersubventionierung von den kostengünstigen Modellen zur traditionellen Versicherung statt. Dies kann im Extremfall dazu führen, dass die Prämieneinnahmen für einen HMO- oder HAM-Versicherten geringer ausfallen als die Zahlung an den Risikoausgleich. Die Versicherer beklagen denn auch, dass sich die Kostenvorteile von HAM nicht in ihren Büchern spiegeln, weshalb sie sich zunehmend aus diesen Modellen verabschieden.
--- ENDE Pressemitteilung Kostendämpfung dank Managed Care ---
Weitere Informationen und Links:

Ein Angebot von HELP.ch
Swiss-Press.com ist ein Angebot von www.help.ch und die spezialisierte Plattform für Pressemitteilungen aus der Schweiz. HELP.ch sorgt für hohe Reichweite, professionelle Veröffentlichung und maximale Sichtbarkeit Ihrer Unternehmensnews.
Medienpräsenz mit «Aktuelle News»: Nutzen Sie das Netzwerk von «Aktuelle News», um Ihre Presse- und Medienmitteilungen, Events und Unternehmensnews gezielt zu verbreiten.
Ihre Inhalte werden über News-Sites, Google, Social Media und Online-Portale einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zum Netzwerk gehören führende Presseportale wie Aktuellenews.ch, News.help.ch, Swiss-Press.com und Tagesthemen.ch, Eventportale wie Eventkalender.ch und Swisskalender.ch sowie Online-TV-Plattformen wie Aktuellenews.tv und Handelsregister.tv. Insgesamt stehen über 30 Publikationskanäle zur Verfügung, um Ihre Mitteilungen optimal zu platzieren.