Versteckte Rationierung in Spitälern
06.07.2003
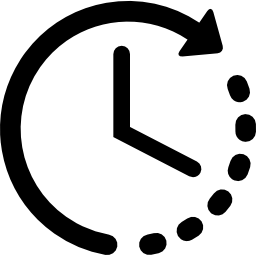 Lesedauer: 7 Minuten
Lesedauer: 7 Minuten
06.07.2003, Um die Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen wird heftig gestritten. Die Einschränkung von medizinischen Leistungen in Spitälern ist jedoch bereits Tatsache Zürich, Stadtspital Triemli, Kardiologie.
Regionalspital, irgendwo in der Schweiz. Ein Patient wird eingeliefert. Herzinfarkt. Er müsste so schnell wie möglich in ein Herzzentrum verlegt werden, am besten per Helikopter. Das Spital schickt ihn aber mit dem langsamen, spitaleigenen Krankenwagen oder aber gar nicht. Grund: Die hohen Kosten für den Transport und den Aufenthalt im Herzzentrum werden dem Regionalspital in Rechnung gestellt.
Diese Beispiele sind keine Einzelfälle. Unserem Gesundheitswesen geht langsam die Luft aus. Jahrelang haben Politiker um Ex-Gesundheitsministerin Ruth Dreifuss eine Diskussion um Rationierungen im Keim erstickt. Trotzdem gehört der Sparzwang - zumindest in Spitälern - längst zum medizinischen Alltag. Angesichts begrenzter Mittel sehen sich viele Ärzte und Spitäler gezwungen, ohne offizielle Richtlinien Gelder und Leistungen zuzuteilen oder ganz zu streichen.
Rationierungen werden schleichend eingeführt. Einzig ein paar wenige spektakuläre Fälle dringen an die Öffentlichkeit: Etwa wenn Alt-Bundesrat Hans-Peter Tschudi ein teures Gerinnungsmedikament vorenthalten wird oder wenn für eine notwendige Leber-Lebend-Transplantation, wie letztes Jahr am Unispital Zürich geschehen, keiner bezahlen will.
Die Entscheide, bei wem und woran gespart wird, trifft gemäss einer Studie des Schweizerischen Tropeninstituts und des Vereins Dialog Ethik meist der behandelnde Arzt. Das Pikante dabei: Die Rationierungen betreffen überwiegend das Personal (Abbau) sowie Leistungseinschränkungen am Patienten, wie etwa abgelehnte Rehabilitationsmassnahmen oder verkürzte Spitalaufenthalte. Und dies, obwohl für die enormen Kostenanstiege meist teure Apparate und die Hightech-Medizin verantwortlich sind.
Wirklich gespart wurde nicht, weil sich die Kosten verlagerten
Wie sich der Rationierungsdruck auf die Spitäler auswirkt, zeigt die Studie auch. Beim Vergleich der offiziellen Gesundheitsausgaben von Zürich und Basel-Stadt fanden die Wissenschaftler, dass die Aufwendungen für stationäre Behandlungen in Spitälern - wo die Ausgaben bereits durch Bettenreduktion, Fallpauschalen und Globalbudgets limitiert sind - im Beobachtungszeitraum von 1991 bis 1999 in Zürich um 4,3 Prozent und in Basel um 1,8 Prozent sanken.
Doch wirklich gespart wurde dabei nicht, die Kosten verlagerten sich lediglich in den ambulanten Bereich. Dort, wo nach wie vor unbeschränkt mit den Krankenversicherungen abgerechnet werden kann, stiegen die Ausgaben im gleichen Zeitraum um 52,4 Prozent beziehungsweise um 27,8 Prozent.
Daraus könne man schliessen, sagt Studienleiterin und Public-Health-Expertin Doris Schopper, dass dort, wo der Finanzdruck steigt, vermehrt rationiert wird. Um zu vermeiden, dass die Einsparungen weiterhin verdeckt - oder, wie Experten sagen, implizit - vorgenommen werden, sei es unabdingbar, Regeln aufzustellen, nach denen die Kürzungen künftig erfolgen sollen. «Derzeit gibt man die Verantwortung für solche Rationierungen Leuten, die sie gar nicht haben wollen», sagt Schopper. «Der schwarze Peter wird den Ärzten zugeschoben.»
So empfinden es auch die Mediziner, die lieber keine Rationierungsentscheide treffen möchten. «Die Menschen kommen zu mir, weil ich ihr Anwalt bin und die bestmögliche Entscheidung für sie treffen soll», sagt Osmund Bertel, Leiter der kardiologischen Abteilung am Stadtspital Triemli: «Wenn die Patienten nun annehmen müssen, dass ich aus ökonomischen Gründen etwas verschleiere, wie können sie mir da vertrauen?»
Dabei ist die Wahl der Therapie - wie etwa die Frage, welcher Patient einen Hightech-Stent kriegt - noch das geringste Problem. Dafür lassen sich, wie im Triemli bereits geschehen, klare Regeln aufstellen. Komplizierter wird es, wenn es um alltägliche Entscheide geht. «Das fängt schon bei der Zeiteinteilung an», sagt Bertel. So wurde etwa die Arbeitszeit der Ärzte in Spitälern gesetzlich begrenzt, der Arbeitsaufwand ist jedoch gleich geblieben - oder hat durch kürzere Aufenthalte und schnellere Patientenwechsel sogar zugenommen.
Notwendige, aber teure Eingriffe könnten künftig verweigert werden
Also muss sich jeder Arzt fragen, wo er die Zeit einsparen kann. Da auf Herz katheteruntersuchungen, Operationen oder andere Therapien kaum verzichtet werden kann, wird etwa bei Operationsaufklärungen an Gesprächszeit mit den Patienten gespart. «Man schmuggelt sich durch, optimiert das Ganze, steht aber dauernd unter dem Druck, dass man nicht das geben kann, was man eigentlich geben sollte», so Bertel.
Steigt der finanzielle Druck weiter, können in Zukunft viele Spitäler auch notwendige, aber teure Operationen nicht mehr durchführen. Am Universitäts-Kinderspital beider Basel etwa werden Kinder operiert, die wegen stark verbogener Wirbelsäulen eine eingeschränkte Lebenserwartung haben. Die neue Therapie kostet 70 000 Franken, doch dem Spital wird nur rund ein Drittel davon erstattet. Spitaldirektor Konrad Widmer befürchtet daher, dass künftig Eingriffe verweigert werden müssen.
Doch wie kann man die nötigen Einschränkungen sinnvoll regulieren und solch «implizite» Massnahmen durch transparente - «explizite» - Rationierungen ersetzen? Mit dieser Frage haben sich verschiedene Länder bereits auseinander gesetzt. Am bekanntesten ist wohl der «Oregon Health Plan», der im US-Bundesstaat Oregon die finanziellen Mittel für die medizinische Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung regeln sollte. Anfang der Neunzigerjahre wurde dafür eine Prioritätenliste erstellt, die sämtliche Therapien nach Kosten, Wirksamkeit und Nutzen einstufte.
Mit fragwürdigem Erfolg: Die erste Liste wurde abgelehnt, weil sie absurde Prioritäten enthielt. Therapien gegen Daumenlutschen etwa oder akute Kopfschmerzen wurden höher eingestuft als die Behandlungen für Aidskranke oder Patienten mit der angeborenen Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose.
Ein ähnliches Fiasko erlebte Neuseeland. Dort wurden statt Leistungslisten Kriterien erarbeitet, die Rangordnungen für die Dringlichkeit der Behandlungen festlegen. So sollte ein Punktesystem bestimmen, wer vorrangig eine Bypassoperation erhält. Doch nachdem ein junger Mann starb, weil er wegen seiner niedrigen Punktzahl nicht operiert wurde, stieg der öffentliche Druck. Schliesslich wurden mehr Gelder für Herzpatienten locker gemacht. Ähnlich verlief die Einführung einer Richtlinie für Dialysebehandlungen, die letztlich ebenfalls mehr statt weniger Ausgaben nach sich zog.
Genau aus diesen Gründen, sagt der Basler Gesundheitsökonom Jürg Sommer, sei jede explizite Rationierung zum Scheitern verurteilt: «Je expliziter solche Entscheidungen sind, desto eher werden Ausweichstrategien entwickelt, und letztendlich muss man dann doch eine Maximalmedizin für alle anbieten.» Sommer findet die bisherige Taktik, des «eleganten Durchwurstelns» daher gar nicht so schlecht. Die Verantwortung für Rationierungen sollte seines Erachtens auch künftig in den Händen der Ärzte liegen.
Sommer fordert allerdings eine Anpassung der ärztlichen Ethik: «Kosten-Nutzen-Abwägungen müssen den Medizinern in Fleisch und Blut übergehen. Schliesslich sind sie auch der Gemeinschaft der Versicherten verpflichtet.»
Doch dafür fehlt - insbesondere bei niedergelassenen Ärzten - derzeit jeder Anreiz. Sommer: «Der Arzt in der Praxis kriegt pro Einzelleistung Geld. Das bedeutet ökonomisch gesehen, je ineffizienter er arbeitet, desto mehr verdient er.» Die Verlockung für Ärzte sei daher gross, immer etwas mehr zu machen als nötig.
Hier müssen laut Sommer Veränderungen ansetzen. Die Aufhebung des Vertragszwangs - das Parlament beschloss Mitte Juni immerhin eine Lockerung - ist für ihn der erste Schritt. Auch die Förderung von Managed-Care-Organisationen, bei denen Versicherte die Form der medizinischen Versorgung wählen können, hält Sommer für eine positive Entwicklung auf dem Weg zu mehr Wettbewerb der seiner Meinung nach das Gesundheitswesen sanieren könnte.
Liberalisierung also als Mittel gegen die explodierenden Gesundheitskosten? Daran wiederum zweifelt Hans Heinrich Brunner: «Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass diese Methode funktioniert.» Wichtig sei jedoch, so der Präsident der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), dass die Diskussion über das richtige Sparmodell in Gang kommt.
Das ist bitter nötig, finden auch Doris Schopper und Jürg Sommer, deren Lö sungsvorschläge ansonsten keinerlei Übereinstimmungen haben. «Meist erfolgen nur Feuerwehraktionen, ohne dass deren Auswirkungen auf das Gesundheitssystem ausreichend abgewogen werden», sagt Schopper. Und Sommer doppelt nach: «Erst wenn das Land in Schulden versinkt, akzeptiert man, dass die Ressourcen knapp sind. Bis dahin versucht man, harten Entscheidungen auszuweichen.»
--- ENDE Pressemitteilung Versteckte Rationierung in Spitälern ---
Hinweis der Redaktion: Die Bildrechte liegen beim jeweiligen Herausgeber.
Weitere Informationen und Links:

Ein Angebot von HELP.ch
Swiss-Press.com ist ein Angebot von www.help.ch und die spezialisierte Plattform für Pressemitteilungen aus der Schweiz. HELP.ch sorgt für hohe Reichweite, professionelle Veröffentlichung und maximale Sichtbarkeit Ihrer Unternehmensnews.
Medienpräsenz mit «Aktuelle News»: Nutzen Sie das Netzwerk von «Aktuelle News», um Ihre Presse- und Medienmitteilungen, Events und Unternehmensnews gezielt zu verbreiten.
Ihre Inhalte werden über News-Sites, Google, Social Media und Online-Portale einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zum Netzwerk gehören führende Presseportale wie Aktuellenews.ch, News.help.ch, Swiss-Press.com und Tagesthemen.ch, Eventportale wie Eventkalender.ch und Swisskalender.ch sowie Online-TV-Plattformen wie Aktuellenews.tv und Handelsregister.tv. Insgesamt stehen über 30 Publikationskanäle zur Verfügung, um Ihre Mitteilungen optimal zu platzieren.



