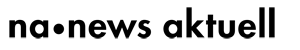Undurchsichtige Verteilung von Krankenkassen-Prämiengeld
13.09.2004
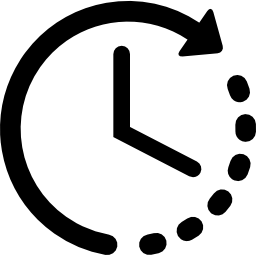 Lesedauer: 5 Minuten
Lesedauer: 5 Minuten
13.09.2004, 2.40 Franken pro Jahr überweist jede Person mit der Krankenkassenprämie an die Stiftung «Gesundheitsförderung Schweiz».
Jetzt hat Innenminister Pascal Couchepin eine externe Evaluation angeordnet. Er wolle Klarheit darüber, was mit dem Geld, das die Stiftung ausgibt, effektiv erreicht werde, sagt Couchepins Sprecherin Katja Zürcher. Ab nächster Woche wird die Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers «Gesundheitsförderung Schweiz» unter die Lupe nehmen. (pho.)
---
Prämiengelder für eine Lach-Gruppe Bundesrat Couchepin will wissen, was die «Gesundheitsförderung Schweiz» mit Prämiengeldern macht
Bundesrat Pascal Couchepin lässt die mit Krankenkassenprämien finanzierte Stiftung «Gesundheitsförderung Schweiz» durch PricewaterhouseCoopers überprüfen.
Pascal Hollenstein Gesundheitsminister Pascal Couchepin will wissen, wie effektiv die Stiftung «Gesundheitsförderung Schweiz» arbeitet. Wie erst jetzt bekannt wird, hat Couchepin bereits im Frühling eine interne Revision der Stiftung durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) angeordnet. Nun wird sie überdies durch das Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers unter die Lupe genommen. Dem Vernehmen nach sollen die Untersuchungen noch in dieser Woche beginnen.
«Die Stiftung finanziert sich über Zwangsabgaben, die jede Person in der Schweiz bezahlen muss», sagt Couchepinsprecherin Katja Zürcher. Deshalb wolle Couchepin vollständige Klarheit darüber, was mit diesem Geld effektiv erreicht werde.
Die Stiftung «Gesundheitsförderung Schweiz», vormals «Stiftung 19» genannt, wird mit einem Zuschlag auf der Krankenkassenprämie von jährlich 2.40 Franken finanziert, was im letzten Jahr knapp 17,5 Millionen Franken einbrachte. 2,5 Millionen davon verschlangen Personal- und Betriebskosten der Stiftung mit 28 Angestellten.
Zum Eklat kam es, als der Stiftungsrat Couchepin eine Erhöhung der Zwangsabgabe auf 3 Franken beantragte. Couchepin lehnte ab und ordnete stattdessen die Untersuchungen an. «Wenn man nicht entscheiden will, lässt man zuerst einmal weitere Berichte anfertigen», ärgert sich der Stiftungsratspräsident und Luzerner Alt- Regierungsrat Klaus Fellmann über den Gesundheitsminister. Er schaue der externen Untersuchung aber «sehr gelassen» entgegen, sagt Fellmann.
«Unregelmässigkeiten» Auf Zustimmung stösst das Vorgehen Couchepins hingegen bei Kritikern der Stiftung. Die Genfer Ständerätin Françoise Saudan sagt, sie sei «glücklich, dass jetzt genau hingeschaut wird». Vor zwei Jahren hatte Saudan in einer Interpellation den Verdacht geäussert, ein Teil der von der Stiftung unterstützten Projekte erfülle das Ziel der Gesundheitsförderung «nur teilweise». Konkret bemängelte Saudan zudem den Kauf eines stattlichen Hauses an bester Berner Lage für 2,75 Millionen Franken zur Unterbringung ihrer Büros in der Deutschschweiz. «Es tauchen immer wieder Unregelmässigkeiten auf», sagt Saudan.
In der Tat finden sich auch unter den neuesten Projekten der Stiftung Vorhaben, die nur mit gutem Willen unter dem Rubrum «Gesundheitsförderung» zusammengefasst werden können. So bewilligte sie im letzten Jahr beispielsweise 2000 Franken für die «Offene Lachgruppe Bern» des Lachtrainers Francesco Muzio. 51 600 Franken flossen in das Projekt «Instrumente für geschlechtergerechte Projekte», eine Grundlagenarbeit, die laut Auftragnehmerin dazu dienen soll, bei der Gesundheitsförderung den «Gender- Aspekt» besser zu berücksichtigen. Weitere 35 000 Franken steckte die Stiftung in eine «Toolbox im Rahmen des Projekts Lebensqualitätsindikatoren». Herausgekommen ist ein Papier, in dem die Autoren sogar selber darauf hinweisen, der Auftrag gehöre eigentlich «nicht zu den Kerngebieten» der Stiftungstätigkeiten. Mittlerweile ist das Projekt deswegen auch an das Bundesamt für Statistik abgetreten worden. Politisch heikel ist, dass die Stiftung mit 50 000 Zwangsabgaben-Franken pro Jahr die «Fachstelle für Gesundheitspolitik» unterstützt - eine Organisation, die bei Parlamentariern für Verschärfungen der Tabakgesetzgebung lobbyiert.
Stiftungspräsident Fellmann und sein Direktor, Bertino Somaini, weisen die Kritik an den Projekten zurück. Politisches Lobbying gehöre zu den Aufgaben seiner Institution, sagt Fellmann, «auch die Tabakindustrie lobbyiert kräftig, nur hat sie viel grössere finanzielle Mittel als wir». Die 35 000 Franken für die «Toolbox» verteidigt Somaini mit dem Argument, in der Schweiz seien Instrumente nötig, um Lebensqualität, die wiederum die Gesundheit beeinflusse, zu messen. Auch das Geld für die «Offene Lachgruppe Bern» sei letztlich gut investiert, denn «es gibt Hinweise darauf, dass Fröhlichkeit zu Wohlbefinden und besserer Gesundheit führt».
Transparenz in Auszügen «Transparenz», findet Stiftungsratspräsident Fellmann im Übrigen grundsätzlich, sei bei einer mit öffentlichen Geldern finanzierten Institution «ein hohes Gebot». Dennoch will er einen Evaluationsbericht, den der Neuenburger Soziologieprofessor Sandro Cattacin erstellt hat, nur in Auszügen veröffentlichen. Darin heisst es, das Umfeld der Gesundheitsförderung verlange «eine hohe Managementkompetenz. Dass es
immer noch gibt, ist deshalb bereits ein Erfolg.» Und weiter: «Dies hat viel damit zu tun, dass eine gesicherte Finanzierung besteht.»
--- ENDE Pressemitteilung Undurchsichtige Verteilung von Krankenkassen-Prämiengeld ---
Weitere Informationen und Links:

Ein Angebot von HELP.ch
Swiss-Press.com ist ein Angebot von www.help.ch und die spezialisierte Plattform für Pressemitteilungen aus der Schweiz. HELP.ch sorgt für hohe Reichweite, professionelle Veröffentlichung und maximale Sichtbarkeit Ihrer Unternehmensnews.
Medienpräsenz mit «Aktuelle News»: Nutzen Sie das Netzwerk von «Aktuelle News», um Ihre Presse- und Medienmitteilungen, Events und Unternehmensnews gezielt zu verbreiten.
Ihre Inhalte werden über News-Sites, Google, Social Media und Online-Portale einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zum Netzwerk gehören führende Presseportale wie Aktuellenews.ch, News.help.ch, Swiss-Press.com und Tagesthemen.ch, Eventportale wie Eventkalender.ch und Swisskalender.ch sowie Online-TV-Plattformen wie Aktuellenews.tv und Handelsregister.tv. Insgesamt stehen über 30 Publikationskanäle zur Verfügung, um Ihre Mitteilungen optimal zu platzieren.