Tarmed - Medizin mit der Stoppuhr
16.11.2003
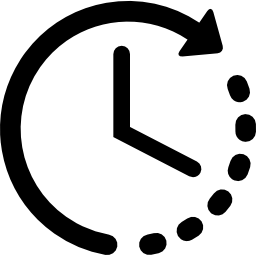 Lesedauer: 8 Minuten
Lesedauer: 8 Minuten
16.11.2003, Das Tarifsystem Tarmed bringt ab dem 1. Januar 2004 erstmals gesamtschweizerisch vergleichbare Verrechnungsmethoden für Spitäler und Privatpraxen. Die Ärzte befürchten, dass der Tarmed zu einer Aufblähung der Verwaltung führt. Die Krankenversicherer erhoffen sich exate Daten, um gezielt kostendämpfende Massnahmen ergreifen zu können.
"Ein Furz genannt Tarmed" überschrieb der Arzt Walter Hess diese Woche eine Kolumne in der "Aargauer Zeitung". Ein "Furz" - um im Vergleich von Hess zu bleiben -, der am 1. Januar 2004 öffentlich wahrnehmbar wird: Auf diesen Zeitpunkt hin wird nämlich das Gesundheitswesen durch die einheitliche Tarifstruktur Tarmed (Tarif médical) umgekrempelt. Alle praktizierenden Ärzte in der Schweiz sowie die rund 400 öffentlichen und privaten Spitäler werden mit den über 90 Krankenkassen nach einer einheitlichen Tarif-Nomenklatur abrechnen. Von den ersten fünf Minuten der Konsultation in der Arztpraxis bis zur kompletten Computer-Tomographie sind im Tarmed-Katalog 4600 Positionen erfasst - fein säuberlich geordnet Organ für Organ, vom Kopf abwärts bis zum Fuss.
Dieses in 17-jähriger Arbeit erstellte Inventar des medizinischen Handwerks, das den Wirrwarr von kantonalen Tarifen und den Spitalleistungskatalog ablöst, ist weltweit einmalig und erweckt auch im Ausland Interesse. So hat die deutsche Kassenärztliche Bundesvereinigung den Tarmed gekauft, der laufend überarbeitet und der Entwicklung der medizinischen Forschung entsprechend angepasst wird. Allerdings gehen die Deutschen in der Detaillierung weniger weit und fassen die 4600 Positionen in rund 600 Leistungspaketen zusammen, was die Abrechnung wesentlich vereinfacht.
Wenig Zeit für Patienten?
Eigentlich sollten die Patientinnen und Patienten nichts von diesem "Big Bang" merken, der den gesamten ambulanten Bereich in der Krankenversicherung erschüttert, in dem Arztpraxen und Kliniken jährlich 7 Milliarden Franken umsetzen. Doch der Allgemeinpraktiker und Kolumnist Walter Fess befürchtet, dass der Patient indirekt unter dem neuen Regime leidet, das die Ärzte zu einer minutengenauen Abrechnung zwingt: "Wenn ich ständig auf die Stoppuhr schauen muss, erhält der Patient das Gefühl, ich hätte keine Zeit für ihn."
Kurt Kaspar, Verwaltungsrat der Argomed Ärzte AG, in der sich 270 Ärztinnen und Ärzte aus dem Kanton Aargau zusammengeschlossen haben, teilt diese Sorge nicht: "Grundversorger werden durch den Tarmed besser gestellt, weil die beratende Tätigkeit gegenüber der operativen aufgewertet wird. Gerade bei Konsultationen fährt der Allgemeinpraktiker besser." Kaspar geht davon aus, dass einige Ärzte übertriebene Ängste vor den Neuerungen haben und sich rasch an das Abrechnungssystem gewöhnen werden. Bei der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH ist man sich bewusst, dass ein gewaltiges Umdenken nötig ist; dieses habe aber bei ihren Mitgliedern schon weitgehend stattgefunden. Zwar sei die Einführung von Tarmed "komplizierter als erwartet", sagt Jacques Weidmann, Leiter des Bereichs Tarife. Doch er ist überzeugt, dass die Rechnungsstellung nach gewissen Startschwierigkeiten mindestens in den Arztpraxen funktionieren wird.
"Wir wissen nicht, was nach der 18-monatigen Einführungsphase geschieht", sagt Peter Marbet von Santésuisse.
Etwas anders präsentiert sich die Lage für die Belegärzte und in den Spitälern, die ab dem 1. Januar 2004 ebenfalls nur noch mit dem Tarmed abrechnen. Hier ist die Einführung des neuen Berechnungssystems mit einem riesigen Schulungsaufwand verbunden, welcher die Betroffenen beinahe verzweifeln lässt. "Wir können ja nicht vor lauter Kursen und Seminaren unsere eigentliche Tätigkeit vernachlässigen", sagt SP-Nationalrat Paul Günter, der als Chefarzt des Instituts für Anästhesie im Regionalspital Interlaken tätig ist. Er kritisiert, dass mit dem Tarmed nur ein riesiger Verwaltungsaufwand verbunden sei, von dem niemand einen konkreten Nutzen habe. Das Gegenteil sei der Fall: "Das ohnehin unter grossem Druck stehende medizinische Personal verbringt immer mehr Zeit am Computer. Seiner eigentlichen Aufgabe, der Betreuung der Patienten, kann es dabei immer weniger nachkommen."
Stephan Hänsenberger, Leiter Tarife bei H+, dem Verband der Schweizer Spitäler, begrüsst es grundsätzlich, dass die unübersichtlichen und verwirrenden Tarifstrukturen bald der Vergangenheit angehören. Doch er kritisiert den übertriebenen Controlling-Gedanken, "der aus dem Kalten Krieg zu stammen scheint". Er glaubt, dass rund 90 Prozent der Spitäler in der Lage sein werden, im Januar und Februar nach dem neuen System abzurechnen. Die restlichen Kliniken müssten ihre Daten aufbewahren, bis die Leistungserfassung und die Computersysteme einwandfrei liefen. Diese Situation haben sich die Leistungserbringer zu einem guten Teil selber zuzuschreiben. Ursprünglich wollte die damalige Gesundheitsministerin Ruth Dreifuss den Tarmed bereits 2001 flächendeckend einführen. Politische Rückzugsgefechte (siehe unten) und zu langes Abwarten führten zu den aktuellen Schwierigkeiten. Je näher der Starttermin rückt, desto mehr konkrete Probleme tauchen auf, die innert kurzer Zeit gelöst werden müssen. So hat sich herausgestellt, dass die Leistungen der Röntgenärzte (Radiologie) im Tarmed zu tief angesetzt worden sind, was für die meisten Radiologieinstitute das Aus bedeuten würde. Mit Notmassnahmen soll dies nun korrigiert werden.
Unklarheit besteht darüber, wie die Leistungen des Pflegepersonals in den Ambulatorien von Kliniken abgerechnet werden. Offene Fragen bestehen auch hinsichtlich des Datenschutzes. Mit dem neuen Abrechnungssystem erhalten die Krankenkassen eine Fülle von Daten, die tiefe Einblicke in die Krankheitsgeschichte ermöglichen.
Klar ist hingegen, dass die Einführung von Tarmed mit grossen Ausgaben verbunden ist. In den meisten Arztpraxen muss die Software erneuert werden. Für die einzelnen Spitäler und Versicherer gehen die Investitionen für EDV, Leistungserfassung und Schulung in die Millionen von Franken. Insgesamt rechnet man bei Santésuisse, dem Dachverband der Krankenkassen, mit Kosten von mehreren hundert Millionen Franken. Bundespräsident Pascal Couchepin hat mehrmals klar gemacht, dass trotz allen ungelösten Problemen am vorgesehenen Einführungstermin nicht gerüttelt wird. Doch die entscheidende Frage ist: Wird der Tarmed dazu führen, dass die Kosten im Gesundheitswesen sinken und die Versicherten Prämien sparen? In diesem Punkt sind sich praktisch alle Player im Gesundheitswesen einig: Nein.
Vorläufig kostenneutral
Für die 18-monatige Einführungsphase haben sich die Vertragspartner FMH, Santésuisse, H+ und der Bund auf Kostenneutralität geeinigt. Der Taxpunktwert (TPW) - mit dem die medizinischen Leistungen benotet und in Geldwert umgesetzt werden - soll laufend so angepasst werden, dass die Gesamtkosten gleich hoch bleiben. Der Start- Taxpunktwert, der in den Kantonen aufgrund von betriebswirtschaftlichen Kriterien zwischen den Vertragspartnern ausgehandelt worden ist, liegt zwischen 78 Rappen im Kanton Wallis und 98 Rappen in Genf. Die Fachleute gehen davon aus, dass dieser Wert bis am 31. Juni 2005 sinken wird, weil die Leistungserbringer versuchen werden, tiefere Tarife durch eine Mengenausweitung aufzufangen: Es werden mehr Leistungen aufgeschrieben, diese jedoch schlechter abgegolten.
"Der Controlling-Gedanke scheint aus dem Kalten Krieg zu stammen", sagt Stephan Hänsenberger von H+
Doch was passiert, wenn dieser künstliche Deckel abgenommen wird, der den Kostendruck im Gesundheitsmarkt eindämmen soll? Sowohl Ärzte wie Versicherer gehen davon aus, dass die Kosten steigen werden. "Ich wäre sehr glücklich, wenn der Tarmed nicht zu sehr viel höheren Ausgaben führen wird", sagt Paul Günter, der darauf hinweist, dass der zusätzliche Kontrollaufwand schliesslich auch bezahlt werden muss. Für eine Verteuerung spricht, dass die im Tarmed erfassten Leistungen auf dem Preisniveau von 2001 fussen, das Lohnniveau des Pflegepersonals auf der Basis von 1995. "Wir wissen nicht, was nach der 18-monatigen Einführungsphase geschieht. Hier ist die Politik gefordert", gesteht Santésuisse-Sprecher Peter Marbet.
Als Mittel zur Kostensenkung war der Tarmed nie konzipiert. Er bildet vielmehr akribisch ab, wie und warum das Gesundheitswesen ständig teurer wird. Vom "Kontrollsystem aus dem Kalten Krieg", wie die Leistungserbringer der ungeliebten Neuerung sagen, erhoffen sich die Krankenkassen jene Aufschlüsse über das Gesundheitswesen, die es erlauben, mittelfristig Massnahmen zu ergreifen, um die Ausgaben zu senken. Es wird dann an den Verantwortlichen in der Politik liegen, die richtigen Schlüsse aus der von Tarmed gelieferten Datenflut zu ziehen und Gegensteuer zu geben.
Privatkliniken fühlen sich benachteiligt
Entscheidend für die Kosten im Gesundheitswesen ist der Taxpunktwert (TPW), mit welchem die im Tarmed-Katalog aufgeführten Leistungen in Franken und Rappen umgewandelt werden. Der Start- Taxpunktwert soll ermöglichen, dass Ärzte und Spitäler ihre Leistungen zu betriebswirtschaftlich begründeten Kosten verrechnen können. Preisüberwacher Werner Marti hat festgelegt, dass der kostenneutrale TPW unter einem Franken liege, und ist in dieser Haltung vom Bundesrat gestützt worden. Doch ergaben Berechnungen für verschiedene Privatspitäler und Vertragsgemeinschaften Taxpunktwerte, die deutlich über einem Franken liegen.
Der Krankenkassenverband Santésuisse ist daher nicht bereit, die errechneten Tarife der Privatkliniken zu akzeptieren. "Jene Spitäler, die sich in der Vergangenheit auf ein bestimmtes, finanziell lukratives Leistungsspektrum konzentriert haben, können dieses Rosinenpicken nun nicht einfach unter dem neuen Regime weiterführen, indem sie ihre Leistungen besser abgelten lassen."
Beim Spitalverband H+ und dem Verband der Privatkliniken Schweiz macht man geltend, die Privatspitäler hätten rund zwanzig Prozent höhere Kosten als die öffentlichen Spitäler, weil sie nicht subventioniert werden. Bisher haben denn auch erst die Privatspitäler im Kanton Thurgau den Vertrag unterschrieben, in welchem der Start-Taxpunktwert definiert wird. Der Verband fordert seine Mitglieder auf, die kantonalen Anschlussverträge nicht zu unterschreiben. So dürfte es in den meisten Kantonen zu einem Festsetzungsverfahren kommen, bei dem die Kantonsregierung den Taxpunktwert bestimmt. Die termingerechte Einführung des Tarmed wird dies jedoch nicht beeinträchtigen.
--- ENDE Pressemitteilung Tarmed - Medizin mit der Stoppuhr ---
Hinweis der Redaktion: Die Bildrechte liegen beim jeweiligen Herausgeber.
Weitere Informationen und Links:

Ein Angebot von HELP.ch
Swiss-Press.com ist ein Angebot von www.help.ch und die spezialisierte Plattform für Pressemitteilungen aus der Schweiz. HELP.ch sorgt für hohe Reichweite, professionelle Veröffentlichung und maximale Sichtbarkeit Ihrer Unternehmensnews.
Medienpräsenz mit «Aktuelle News»: Nutzen Sie das Netzwerk von «Aktuelle News», um Ihre Presse- und Medienmitteilungen, Events und Unternehmensnews gezielt zu verbreiten.
Ihre Inhalte werden über News-Sites, Google, Social Media und Online-Portale einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zum Netzwerk gehören führende Presseportale wie Aktuellenews.ch, News.help.ch, Swiss-Press.com und Tagesthemen.ch, Eventportale wie Eventkalender.ch und Swisskalender.ch sowie Online-TV-Plattformen wie Aktuellenews.tv und Handelsregister.tv. Insgesamt stehen über 30 Publikationskanäle zur Verfügung, um Ihre Mitteilungen optimal zu platzieren.



