SNF: Grabsteine zeugen von hoher Baukunst in der Jungsteinzeit
29.04.2022 | von Schweizerischer Nationalfonds SNF
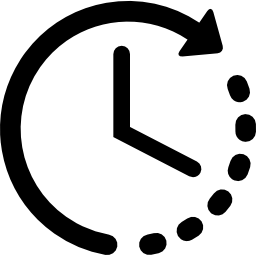 Lesedauer: 4 Minuten
Lesedauer: 4 Minuten
29.04.2022, Bern (ots) - Die Menschen vor 5000 Jahren konnten bauen und haben wohl über Generationen am selben Ort gewohnt - eine alte Grabstätte in Oberbipp lässt tief in die Jungsteinzeit blicken.
Ein im Jahr 2012 entdecktes jungsteinzeitliches Grab in der Nähe von Oberbipp (BE) hat sich als wahre Schatztruhe für die Wissenschaft erwiesen. Nach zehn Jahren legt das multidisziplinäre Forschungsteam, das vom Schweizerischen Nationalfonds mitfinanziert wurde, nun die vorläufig letzte Studie dazu vor. Neue Erkenntnisse zum Bau und der Geschichte des aus Steinblöcken errichteten Grabes, ein sogenannter Dolmen, ergeben zusammen mit vorherigen Untersuchungen ein überraschend klares Bild der Menschen, die vor 5000 Jahren am Südfuss des Juras lebten.
Hoher technischer Verstand
"In diesen zehn Jahren konnten wir durch einen Sprung in der Entwicklung der Methoden, besonders im Bereich der Anthropologie, viel mehr herausfinden, als wir uns je erträumt haben", sagt die Archäologin Marianne Ramstein vom archäologischen Dienst des Kantons Bern. Sie hat sich vor allem mit der Konstruktion des aussergewöhnlich gut erhaltenen Dolmens befasst. So fand sie heraus, dass die Steine für die Grabkammer alle aus dem Umkreis von etwa einem Kilometer stammten. "Die Anlage wurde mit grossem Aufwand gebaut", so Ramstein "Es wurden gezielt verschiedene Steinarten ausgesucht und sorgfältig zusammengesetzt, was von hohem technischem Verständnis zeugt." Als Beispiel nennt sie die Wahl einer Platte aus Kalktuff für den Eingang - einem Stein, der leicht zu bearbeiten und einzupassen ist.
Gemeinsam mit dem Institut für Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie der Universität Basel hat Ramstein auch ermittelt, was mit dem Dolmen in den folgenden Epochen passierte. Zur Zeit des Römischen Kaiserreiches und im Frühmittelalter war das Grab wahrscheinlich noch sichtbar und wurde von Menschen besucht - das belegen etwa zeitgenössische Keramikscherben. Vom Mittelalter an wurde das Land dann regelmässig geflutet, um es fruchtbar zu machen. Das eingeschwemmte Sediment deckte das Grab nach und nach zu, bis in der Neuzeit nur noch die Spitze herausschaute. "Diese lokaltypische Landwirtschaftsform verhinderte eine frühere Entdeckung und hat zur besonders guten Erhaltung des Baus beigetragen", so Ramstein. Feines Sediment versiegelte auch die Lücken zwischen den Steinen, wodurch die Skelette von 42 dort begrabenen Menschen konserviert wurden.
Männer aus drei Generationen
Die anthropologische Untersuchung dieser Überreste durch die Forschungsgruppe um Sandra Lösch von der Universität Bern und ein Team des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena lieferte im Laufe der Jahre eine Fülle von Informationen. Hierfür studierten die Forschenden unter anderem die Knochen, bestimmten die chemische Zusammensetzung der Zähne und analysierten die Verwandtschaft durch DNA-Analysen. "Die Ergebnisse zeigen zum Beispiel, dass sich die Menschen damals für längere Zeit in der Nähe des Dolmens niedergelassen hatten, denn es waren männliche Verwandte aus mindestens drei Generationen darin begraben", so Lösch. Die darin begrabenen Frauen stammten möglicherweise aus anderen Regionen. Ausserdem konnte man aus den Untersuchungen schliessen, dass sich die Begrabenen hauptsächlich von den Erträgen aus Ackerbau und ein wenig Viehzucht ernährt hatten.
"An den Schweizer Seen gibt es viele gut untersuchte Überreste von Siedlungen aus der Jungsteinzeit. Aber über die Menschen, die damals im Hinterland lebten, war bisher praktisch nichts bekannt", sagt Ramstein. Aufgrund der dort herrschenden Umweltbedingungen blieben meistens weder Bauten noch Keramik noch Skelette erhalten. "Der Fund von Oberbipp hilft uns, diese Forschungslücke zu schliessen." Dafür haben auch die Menschen vor 5000 Jahren gesorgt, als sie für ihre Toten mit besonderer Sorgfalt und Hingabe eine Grabstätte errichteten, die bis heute überdauert hat.
M. Ramstein et al.: The well-preserved Late
Neolithic dolmen burial of Oberbipp, Switzerland. Construction, use, and post-depositional processes.
Journal of Archaeological Science: Reports (2022).
Kontakt
Marianne Ramstein
Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern
Archäologischer Dienst
Postfach
3001 Bern
Tel.: +41 31 633 98 48
E-Mail:
Sandra Lösch
Institut für Rechtsmedizin
Universität Bern
Murtenstrasse 26
3008
Bern
Tel.: +41 31 684 02 06
E-Mail:
Pressekontakt:
Schweizerischer Nationalfonds
Kommunikation
Wildhainweg
3
Postfach
3001 Bern
+41 31 308 23 87
com@snf.ch
--- ENDE Pressemitteilung SNF: Grabsteine zeugen von hoher Baukunst in der Jungsteinzeit ---
Hinweis der Redaktion: Die Bildrechte liegen beim jeweiligen Herausgeber.
Über Schweizerischer Nationalfonds SNF:
Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) fördert im Auftrag des Bundes die Forschung in allen wissenschaftlichen Disziplinen, von Geschichte über Medizin bis zu den Ingenieurwissenschaften
Um die nötige Unabhängigkeit sicherzustellen, wurde der SNF 1952 als privatrechtliche Stiftung gegründet. Im Zentrum seiner Tätigkeit steht die Evaluation von Forschungsgesuchen. Mit der kompetitiven Vergabe öffentlicher Gelder trägt der SNF zur hohen Qualität der Schweizer Forschung bei.
In enger Zusammenarbeit mit Hochschulen und weiteren Partnern setzt sich der SNF dafür ein, dass sich die Forschung unter besten Bedingungen entwickeln und international vernetzen kann. Besondere Aufmerksamkeit schenkt der SNF dabei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Zudem übernimmt er im Rahmen von Evaluationsmandaten die wissenschaftliche Qualitätskontrolle von grossen Schweizer Forschungsinitiativen, die er nicht selbst finanziert.
Hinweis: Der Über-uns-Text stammt aus öffentlichen Quellen oder aus dem Firmenporträt auf HELP.ch.
Quellen:
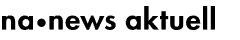

Weitere Informationen und Links:

Ein Angebot von HELP.ch
Swiss-Press.com ist ein Angebot von www.help.ch und die spezialisierte Plattform für Pressemitteilungen aus der Schweiz. HELP.ch sorgt für hohe Reichweite, professionelle Veröffentlichung und maximale Sichtbarkeit Ihrer Unternehmensnews.
Medienpräsenz mit «Aktuelle News»: Nutzen Sie das Netzwerk von «Aktuelle News», um Ihre Presse- und Medienmitteilungen, Events und Unternehmensnews gezielt zu verbreiten.
Ihre Inhalte werden über News-Sites, Google, Social Media und Online-Portale einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zum Netzwerk gehören führende Presseportale wie Aktuellenews.ch, News.help.ch, Swiss-Press.com und Tagesthemen.ch, Eventportale wie Eventkalender.ch und Swisskalender.ch sowie Online-TV-Plattformen wie Aktuellenews.tv und Handelsregister.tv. Insgesamt stehen über 30 Publikationskanäle zur Verfügung, um Ihre Mitteilungen optimal zu platzieren.





