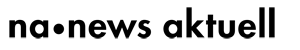seco: Mehr Zuwanderung und Wachstum dank Personenfreizügigkeit
02.07.2009 | von Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
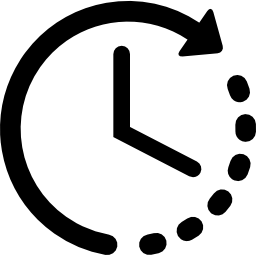 Lesedauer: 4 Minuten
Lesedauer: 4 Minuten
02.07.2009, Bern - Der erleichterte Zugang zu Fachkräften aus dem EU-Raum begünstigte das hohe Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum der letzten Jahre. Die Konkurrenz für die inländischen Arbeitnehmenden dürfte durch die Öffnung des Arbeitsmarktes tendenziell gestiegen sein. Eine Verdrängung ansässiger Erwerbspersonen oder eine wegen der Personenfreizügigkeit höhere Arbeitslosigkeit waren jedoch nicht feststellbar. Eine negative Entwicklung bei tiefen Löhnen konnte durch die Flankierenden Massnahmen weitgehend verhindert werden. Das sind die Ergebnisse des 5. Observatoriumsberichts über die Auswirkungen der Personenfreizügigkeit seit Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens Schweiz-EU am 1. Juni 2002.
Der Anstieg der Zuwanderung in den sechs Jahren nach Inkrafttreten des FZA dürfte unter anderem mit einem erhöhten Wirtschafts-Wachstum in dieser Phase zu erklären sein. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Netto-Zuwanderung in den ersten sechs Jahren nach Inkrafttreten des FZA tendenziell höher ausfiel als in konjunkturell vergleichbaren Situationen in der Vergangenheit. Dies spricht dafür, dass das FZA die Zuwanderung von Arbeitskräften in die Schweiz insgesamt begünstigt hat.
Im Zuge der aktuellen Wirtschaftskrise zeigen jüngste Zahlen zu den effektiven Neuzugängen in den Schweizer Arbeitsmarkt eine leicht rückläufige Tendenz. Es ist zu vermuten, dass sich die Zuwanderung mit einer gewissen Verzögerung auf die aktuelle Arbeitsmarktentwicklung noch deutlich stärker abschwächen wird.
Die Qualifikationsstruktur der Zuwanderung richtet sich unter der Personenfreizügigkeit nach den Bedürfnissen der Wirtschaft. Der Trend zur Zuwanderung von hoch qualifizierten Arbeitskräften wurde durch die Personenfreizügigkeit gestützt. Von den zwischen Juni 1997 und Mai 2007 neu zugewanderten Arbeitskräften der ständigen Wohnbevölkerung verfügten durchschnittlich 50% über eine Hochschulausbildung und 81% mindestens über einen Abschluss auf der Sekundarstufe II.
In den Jahren 2006 bis 2008 fiel das Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum in der Schweiz ausserordentlich hoch aus. Der erleichterte Zugang zu Fachkräften aus dem EU-Raum unterstützte diesen Aufschwung und ermöglichte den Unternehmen, die Problematik des Fachkräftemangels in Hochkonjunkturphasen einzudämmen. Die Zunahme der Erwerbstätigkeit im Zeitraum 2003 bis 2008 konzentrierte sich insbesondere auf Berufsgruppen mit hohen Qualifikationsniveaus. Auf dieselben Berufsgruppen fiel auch die Zuwanderung aus dem EU/ EFTA-Raum. Dies spricht dafür, dass die Zuwanderung mehrheitlich eine willkommene Ergänzung zur ansässigen Erwerbsbevölkerung darstellte. In Regionen mit hoher Grenzgängerbeschäftigung war auch eine gewisse Zunahme von unqualifizierten Arbeitskräften aus den Nachbarländern feststellbar. Eine gewisse Verdrängung einheimischer Arbeitskräfte ist hier nicht ganz auszuschliessen.
Die Arbeitslosenquote von Schweizer/innen lag immer deutlich unter dem Niveau von Ausländer/innen. Die Arbeitslosenquote von Personen aus dem EU15/EFTA-Raum lag dabei jedoch weniger als halb so hoch wie jene von Drittstaatenangehörigen. Gegenwärtig steigt die Arbeitslosenquote der Ausländer/innen aus dem EU15/EFTA-Raum überproportional an. Aufgrund ihrer vielfach erst kurzen Betriebszugehörigkeit und der starken Vertretung in der Industrie und in der Temporärbranche gehören sie mit zu den ersten Betroffenen der aktuellen Wirtschaftskrise.
Auf die Lohnentwicklung der ansässigen Erwerbstätigen lassen sich bis heute keine eindeutigen Schlussfolgerungen ziehen. Eine vorübergehende Dämpfung der nominalen Lohnentwicklung ist denkbar. Untersuchungen zur Lohnentwicklung nach Branchen lassen allerdings keinen Einfluss einer erhöhten Zuwanderung erkennen. Auch negative Effekte der Zuwanderung auf die Lohnentwicklung im Bereich tiefer Löhne sind nicht festzustellen. Wie die Erfahrungen mit den flankierenden Massnahmen zeigen, werden die üblichen Lohnbedingungen in der Schweiz durch ausländische Entsendebetriebe und Schweizer Unternehmen, welche ausländische Arbeitskräfte beschäftigen, in der Regel eingehalten.
--- ENDE Pressemitteilung seco: Mehr Zuwanderung und Wachstum dank Personenfreizügigkeit ---
Über Staatssekretariat für Wirtschaft SECO:
Das SECO ist das Kompetenzzentrum des Bundes für alle Kernfragen der Wirtschaftspolitik. Sein Ziel ist es, für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu sorgen. Dafür schafft es die nötigen ordnungs- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen.
Arbeitgebende und Arbeitnehmende sollen von einer wachstumsorientierten Politik, vom Abbau von Handelshemmnissen und von der Senkung der hohen Preise in der Schweiz profitieren.
Weitere Informationen und Links:

Ein Angebot von HELP.ch
Swiss-Press.com ist ein Angebot von www.help.ch und die spezialisierte Plattform für Pressemitteilungen aus der Schweiz. HELP.ch sorgt für hohe Reichweite, professionelle Veröffentlichung und maximale Sichtbarkeit Ihrer Unternehmensnews.
Medienpräsenz mit «Aktuelle News»: Nutzen Sie das Netzwerk von «Aktuelle News», um Ihre Presse- und Medienmitteilungen, Events und Unternehmensnews gezielt zu verbreiten.
Ihre Inhalte werden über News-Sites, Google, Social Media und Online-Portale einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zum Netzwerk gehören führende Presseportale wie Aktuellenews.ch, News.help.ch, Swiss-Press.com und Tagesthemen.ch, Eventportale wie Eventkalender.ch und Swisskalender.ch sowie Online-TV-Plattformen wie Aktuellenews.tv und Handelsregister.tv. Insgesamt stehen über 30 Publikationskanäle zur Verfügung, um Ihre Mitteilungen optimal zu platzieren.